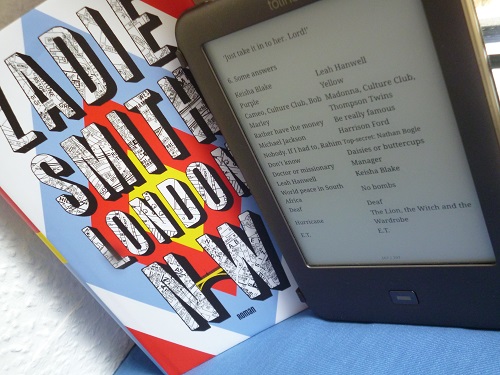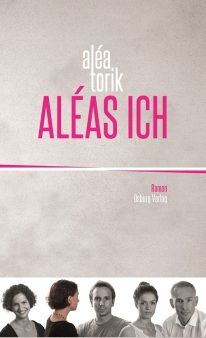Es ist wieder soweit: Das Jahr 2014 geht zu Ende und wir blicken auf ein Jahr voller großartiger oder auch enttäuschender Leseerlebnisse zurück. Aus über 84 Büchern, die wir dieses Jahr gelesen haben, suchen wir die für uns persönlich am interessantesten oder ernüchterndsten heraus und ziehen hier ein Resümee. Nicht jedes Buch war ein Lesevergnügen, aber wir haben viel daraus gelernt. Es bleiben am Ende nur unsere persönlichen Eindrücke. Möge sich jeder Leser selbst eine Meinung bilden, uns widersprechen oder seinen Eindruck mit uns teilen.
Die 5 überzeugendsten Bücher des Jahres
 … von Katja:
… von Katja:
Siri Hustvedt: „Leben, Denken, Schauen“ (Essays)
Siri Hustvedt ist einfach eine großartige Autorin und hat mich auch mit ihren Essays total überzeugt. Denn sie verknüpft auf sehr unterhaltsame, kluge Weise literaturwissenschaftliche, soziologische, psychologische und philosophische Gedanken, die zum Nachdenken anregen und einen unheimlichen Wissensschatz beherbergen.
Aléa Torik: „Das Geräusch des Werdens“
Aléa Torik war für mich ja schon DIE Entdeckung des letzten Jahres und hält auch im zweiten Roman wieder, was ich erwartet habe. Ihr Debütroman über die Verflechtungen der Bewohner eines rumänischen Dorfes verknüpft Poesie und originelle Erzählkunst. Ein eindrucksvolles Leseerlebnis!
Jonathan Safran Foer „Extrem laut und unglaublich nah“
Die Geschichte des kleinen traurigen Oskars, der in New York nach dem 11. September seinen Vater sucht, hat mich nachdrücklich berührt. Jonathan Safran Foer gehört für mich zu meinen absoluten Lieblingsautoren, die ich jedem empfehlen würde.
Virginia Woolf: „Mrs. Dalloway“
Virginia Woolf ist als Frau und Schriftstellerin die Vorreiterin der modernen englischen Literatur. „Mrs. Dalloway“ ist literarisch und stilistisch großartig und sollte von jedem gelesen werden.
Ray Bradbury „Fahrenheit 451“
Dieser Klassiker der Science-Fiction-Literatur hat nicht unbedingt des höchsten sprachlichen Anspruch, ist aber vom Inhalt her wahnsinnig interessant und hochspannend: Eine frühe Dystopie über die moderne Unterhaltungsgesellschaft, die Bücher verbrennt und unter Strafe stellt und ihre Gesellschaft mit Drogen ruhig stellt.
… von Laura:
Aléa Torik: „Aléas Ich“
Ein bemerkenswerter Roman über Fiktionalität, Stadtleben, Identität und das Spiel mit der Wirklichkeit. Die fiktive Autorin schreibt auf innovative und eindrucksvolle Weise über eine Figur ihres Namens und die Entstehung eines Romans, den der Leser in den Händen hält.
Hier der Link zu einem Interview von Katja mit Aléa Torik zum Roman.
David Foster Wallace: „In alter Vertrautheit“ (Stories)
Wer sich bisher noch nicht an David Foster Wallace herangetraut hat, findet in den Stories einen guten Einstieg: Es geht um skurrile Alltäglichkeiten, umfangreich recherchierte Details, schillernde Charaktere und das alles ist in einer postmodernen einfallsreichen Sprache verpackt.
Eine Besprechung zu zwei Storybänden von David Foster Wallace findet ihr hier.
Wolfgang Herrndorf: „Arbeit und Struktur“
Dieses Buch hat mich dieses Jahr ganz besonders bewegt. Es handelt sich um die gedruckte Form des Blogs, den Herrndorf hier veröffentlichte, ursprünglich um seine Freunde an seiner Auseinandersetzung mit der Diagnose Glioblastom teilhaben zu lassen.
An dieser Stelle findet er mehr meiner Eindrücke und Gedanken zum Buch.
David Mitchell: „Die tausend Herbste des Jacob de Zoet“
Mitchell, der mich bereits durch seinen „Wolkenatlas“ beeindruckte, erzählt in diesem umfangreichen Roman von Niederländern im 18. Jahrhundert in Japan und die Geschichte Jacob de Zoets, der sich in die japanische Hebamme Orito verliebt. Eine klassisch-stringente Erzählung die eine große Sogwirkung entfaltet und die eine oder andere Überraschung bereithält.
Link zur Rezension des Buches
Siri Hustvedt: „The Blazing World“
Siri Hustvedt hat mich dieses Lesejahr nicht nur durch ihre Essays beeindruckt, sondern auch durch ihren jüngsten Roman, in dem es um die Künstlerin Harriet Burden geht, die ihre Werke von drei männlichen Stellvertretern ausstellen lässt. Wie häufig bei der Autorin geht es um Fragen der Identität, um den Kunstmarkt, Gender und Psychologie.
Link zur Rezension des Buches
Die 5 enttäuschendsten Bücher des Jahres
 … von Laura:
… von Laura:
David Wonschewski: „Geliebter Schmerz. Melancholien“
Geschichten, die die Melancholie und den Schmerz als wertvoll für das Leben und die menschliche Erfahrung erscheinen lassen wollen, die aber bemüht und teils klischeebelastet daherkommen, langweilen und letztlich belanglos bleiben.
Link zur Besprechung der Geschichten
Joel Haahtela: „Der Schmetterlingssammler“
Seichte Lektüre für zwischendurch, deren einziger Höhepunkt im Ende besteht, wenn es auf eine psychologische Erklärung der Handlung hinausläuft… Ansonsten: uninteressante Charaktere mit überstrapazierten Bildern (Schmetterlinge, altes, verlassenes Haus, Staub im lichtdurchfluteten Zimmer, geheimnisvolles Erbe…).
Edouard Lévé: „Selbstmord“
Ein Erzähler richtet sich in 2.Person Plural an jemanden, der sich umgebracht hat – das klang vielversprechend, besonders unter Berücksichtigung dessen, dass Lévé selbst sich nach Abgabe des Manuskripts umbrachte. Doch es geschieht nichts, man erfährt nicht viel über den Selbstmörder und sonderlich nah geht es leider auch nicht.
Pierre Michon: „Leben der kleinen Toten“
Michons kleine Geschichten von Menschen, die bereits tot sind, sind derart schwurbelig und „auf alt gemacht“ geschrieben, dass es nur langweilt, sie zu lesen. Ich musste das Buch, das ich für unseren Literaturkreis lesen wollte, aus Motivationslosigkeit leider abbrechen.
Helwig Arenz: „Der böse Nik“
In Arenz´ Debütroman geht es vorwiegend um Grenzüberschreitungen moralischer Art, Gesetzesbrüche und das Leben unter Drogeneinfluss. Das Buch liest sich unterhaltsam und bitterböse, und es weist einige wenige poetische Stellen auf, die aber für den krachenden, ereignisreichen Gesamtkontext zu leise sind, und darin untergehen.
Link zur Besprechung von mir auf „Das Debüt“
… von Katja:
David Mitchell „Der Wolkenatlas“
Leider für mich eine kleine Enttäuschung und nicht so überzeugend, wie es für Laura es war. Die Geschichte war für mich nicht rund, schlüssig und stringent erzählt und hat mich einfach nicht so gepackt.
Dave Eggers „Der Circle“
Dieser Roman über den Twitter-Facebook-Google ähnlichen Konzern „The Circle“, der als bahnbrechende Dystopie angekündigt wurde, fand ich völlig inspirationslos und überschätzt. Für mich leider ein enttäuschendes Leseerlebnis ohne Esprit, mit blassen Figuren und ohne wirklich stringenten moralischen Zündstoff.
Haruki Murakami „Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki“
Eigentlich mag ich Murakami sehr und war begeistert von „Naokos Lächeln“. Dieser jüngste Roman hat mich sprachlich und inhaltlich sehr enttäuscht, wegen seiner farblosen Figuren, überladen-erzwungenen Metaphern und unschlüssigen Figurencharakteristik sowie Handlung.
Gerbrand Bakker „Der Umweg“
Das im Rahmen eines Lesekreises gelesene Buch hat mich überhaupt nicht gepackt oder berührt und war daher ein überflüssiges Leseerlebnis. Sehr leise und still erzählt mit geringer Figurendramatik und seltsam-absurden Dialogen, ohne Sprachkunst.
J.M. Coetzee „Leben und Zeit des Michael K.“
Nobelpreisträger Coetzee konnte mich leider auch nicht überzeugen und der Sinn oder die Botschaft der Geschichte ließ sich für mich nicht erschließen. An den oft mit ihm verglichenen Franz Kafka kommt er meiner Meinung nach um Längen nicht heran.
*** Wir wünschen euch einen guten Start ins Lesejahr 2015!!! ***
 Am Ende bleibt nur ein Haufen Manuskriptseiten in einer Garage. Als sich der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace im September 2008 das Leben nimmt, hinterlässt er den unvollendeten Roman „Der bleiche König“. Ich bin sicher, er wäre großartig geworden.
Am Ende bleibt nur ein Haufen Manuskriptseiten in einer Garage. Als sich der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace im September 2008 das Leben nimmt, hinterlässt er den unvollendeten Roman „Der bleiche König“. Ich bin sicher, er wäre großartig geworden.